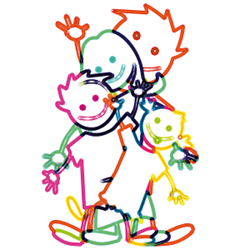Im Gespräch: Prof. Dr. Dr. Andreas Pfützner, Diabetologe, Professor für Innere Medizin und Labormedizin und internationaler Experte für moderne Diabetes-Therapien, betreut eine Familie aus Ingelheim, deren Töchter nach der überraschenden Diagnose Typ-1-Diabetes im Herbst 2022 an der Freien Waldorfschule Mainz immer wieder auf massive Hürden gestoßen ist — von „ignorierten Attesten“, „verweigerter Kommunikation“ bis hin zu einer „unbegründeten Jugendamtsmeldung“. (*)
Redaktion: Herr Professor Pfützner, Sie betreuen die Familie seit Jahren. Wie bewerten Sie den Umgang der Waldorfschule Mainz, auch des Klassenlehrers, mit der chronischen Erkrankung Ihrer Patientinnen?
Prof. Pfützner: Das Verhalten der Schule und des verantwortlichen Lehrers, der trotz eines gerade manifestierten Diabetes Typ 1 den Eltern erst massiv Druck macht und dann die Kommunikation sogar aufkündigt, ist aus meiner Sicht vollkommen unverantwortlich – und Diskriminierung pur. Mir liegt der Kommunikationsverlauf im Übrigen vor, da die Eltern sich hilfesuchend an mich gewandt hatten, nachdem ihnen plötzlich wegen gehäufter Verspätungen durch morgendliche Blutzuckerschwankungen (ein häufiges Phänomen bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1) vom Lehrer „Ordnungsmaßnahmen“ oder „Attestpflicht“ angedroht wurden. Dies zeigt ein erschreckendes Maß an Unwissenheit und mangelnder Sensibilität für eine ernst zu nehmende chronische Erkrankung wie Typ-1-Diabetes bei Kindern.
Redaktion: Können Sie konkreter ausführen, wo hier nach Ihrer Ansicht die Missstände liegen?
Prof. Pfützner: Statt Verständnis für nicht vermeidbare Fehlzeiten oder Verspätungen aufzubringen (die medizinisch absolut begründbar sind), wurden die Eltern unter Druck gesetzt und mussten sich sogar den Vorwurf gefallen lassen, die Schulpflicht nicht ernst genug zu nehmen. Es wurden offensichtlich gleich im ersten Schritt „Sanktionen“ in den Raum gestellt, bevor überhaupt ein klärendes Gespräch zum Umgang mit Diabetes im Schulalltag geführt oder Verspätungen als Problem thematisiert worden waren – insgesamt lagen zu diesem Zeitpunkt ja nicht mal viele Fehltage vor, was auch klar und deutlich aus dem Kommunikationsverlauf hervorgeht. Vom Lehrer wurden den Eltern dann sogar die hohen Fehltage nach der Diagnose im letzten Schuljahr vorgeworfen. Und behauptet, viele Tage wären eigentlich unentschuldigt, was gar nicht stimmte. Die Tochter war nach der Diagnose auf der Intensivstation und länger im Krankenhaus, später vier Wochen in einer medizinisch verordneten Reha – natürlich waren die Fehlzeiten da hoch!
Ich hätte in der Situation natürlich sofort mit einem umfassenden Attest aushelfen können und hätte auch für ein klärendes Gespräch zur Verfügung gestanden, wenn notwendig. Auch hätte es die Möglichkeiten professioneller Schulungen durch meine Praxis gegeben, aber Schule und Lehrer waren offenbar nicht interessiert an Hilfestellungen für die Familie und einem transparenten und guten Dialog mit ihr – was ja die Grundlage für einen guten Umgang mit Diabetes in der Schule ist. Dann klappt es normalerweise auch, dass ein betroffenes Kind problemlos und unbeschwert die Schule besuchen kann.
Redaktion: Was wäre nach Ihrer Ansicht eine angemessene Reaktion von der Schule gewesen?
In jedem Fall ein wenig Bereitschaft und Verständnis sowie eine gute Kommunikation mit der Familie. Ein professioneller Umgang des Klassenlehrers wäre hier konkret gewesen: Im ersten Schritt das Gespräch mit den Eltern zu suchen, auf Probleme rechtzeitig und angemessen hinzuweisen und nachzufragen – und natürlich auch ein gewisses Maß an Unterstützung anzubieten und ärztliche Hinweise ernst zu nehmen. Das schreibt allein die Fürsorgepflicht der Lehrenden und der gemeinsame Erziehungsauftrag zwischen Eltern und Schulpersonal vor. Die wichtigsten medizinischen Aspekte im Schulalltag habe ich nach den „Sanktionsandrohungen“ des Lehrers an die Eltern umgehend für die Schule in einem Attest klar formuliert und morgendliche Verspätungen wegen Schwankungen des Blutzuckers erklärt — aber es wurde in weiten Teilen offensichtlich ignoriert oder nicht wirklich ernst genommen.
Redaktion: Die Eltern haben einen Nachteilsausgleich für ihre Tochter beantragt. Wie wichtig ist dieser — und wie sollte damit umgegangen werden?
Prof. Pfützner: Ein medizinisch begründeter Nachteilsausgleich ist kein „Kann“, sondern ein rechtlich verankertes Muss. Er sorgt dafür, dass Kinder mit einer chronischen Erkrankung und Behinderung die Chance haben, den Schulalltag so bewältigen zu können wie ihre gesunden Mitschüler. Ich habe in einem Arztbrief genau dargelegt, welche Rücksichtnahmen nötig sind — z.B. jederzeit Handynutzung u.a. zur Insulinabgabe, Toleranz bei medizinisch begründeten Verspätungen/ Fehlzeiten und ein offener Austausch zwischen Lehrkräften und Eltern. Dass dieser Nachteilsausgleich dann von der Schule in vielen Punkten ignoriert wurde, ist ein klarer Verstoß gegen das Gebot der gleichberechtigten Teilhabe. Und wenn Schule und Lehrer schon so damit umgehen, wird ihnen sicherlich auch keine Sensibilisierung der Mitschüler/innen zum wertschätzenden und verständnisvollen Umgang gelingen.
Redaktion: Wie bewerten Sie die Kommunikationsweigerung des Klassenlehrers gegenüber den Eltern?
Prof. Pfützner: Das ist für mich eines der größten Versäumnisse in diesem ganzen Fall. Gerade bei Diabetes ist der regelmäßige Austausch zwischen den Eltern und dem verantwortlichen Klassenlehrer entscheidend — man muss über Blutzuckerwerte, Besonderheiten im Tagesablauf oder anstehende Klassenfahrten sprechen. Dass der Klassenlehrer die Kommunikation einfach eingestellt hat — und die Schulleitung das auch noch geduldet hat — ist aus meiner Sicht grob fahrlässig. Es zeigt für mich, dass hier nicht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht, sondern eine völlig falsche Konfliktkultur und scheinbar auch eine zweifelhafte Sicht auf Krankheit und Behinderung. Ich erinnere nur an den tragischen „Fall Emily“, der durch die Presse ging: Ein Kind mit Diabetes starb auf einer Klassenfahrt an den Folgen von Überzucker, weil grundlegende Absprachen gefehlt hatten. Die Lehrerinnen wurden rechtskräftig wegen fahrlässiger Tötung aufgrund von Unterlassung verurteilt. So etwas darf sich niemals wiederholen.
Redaktion: Zu einer besonderen Eskalation kam es bei einem Elternabend, auf dem der Vater nach vielen gescheiterten Versuchen die Kommunikation mit dem Klassenlehrer wieder aufnehmen und ruhig und sachlich über die Notwendigkeit zu dringenden Absprachen zu Diabetes – insbesondere angesichts der anstehenden Klassenfahrt – sprechen wollte. Der Klassenlehrer verbot ihm jedoch das Wort und verwies ihn sogar des Raumes. Wie schätzen Sie den Rauswurf und die Begründung der Schulleitung dazu ein, der Vater habe hier ein „Privatanliegen“ vorgetragen, das er nicht vorher angekündigt habe – daher habe der Lehrer allen Grund für dieses drastische Vorgehen gehabt?
Prof. Pfützner: Dieser unfassbare Vorfall beweist erneut eine völlige Verkennung der Situation — und zeigt einmal mehr, dass hier nicht nur grundlegendes Wissen über chronische Erkrankungen fehlt, sondern offenbar auch über die eigenen schulischen Pflichten und Aufgaben. Gerade von einer Waldorfschule hätte ich ein derartiges Verhalten nun wirklich nicht erwartet. Wie kann es sein, dass der Vater überhaupt in die Situation gebracht wurde, auf einem Elternabend endlich um eine Kommunikationsaufnahme zu bitten?! Es ist selbstverständlich kein Privatanliegen, wenn Eltern mit dem Klassenlehrer über notwendige Absprachen zum sicheren Umgang mit einer (potentiell lebensbedrohlichen) Stoffwechselerkrankung sprechen wollen — das ist eine Pflichtaufgabe der Schule. Gerade bei einer Klassenfahrt muss vorab alles geklärt sein: Wer ist geschult? Was passiert im Notfall? Was ist konkret zu tun bei Alarmen oder akuten technischen Problemen? Mit welcher individuellen Technik ist das Kind ausgestattet und wie funktioniert diese? Auf welche Symptome muss geachtet werden? Diese Fragen sind zentral für die Sicherheit des Kindes.
Der Vater hat hier völlig zu Recht das Gespräch eingefordert, nachdem die Kommunikation vorher wiederholt blockiert wurde. Dass ihm dann das Wort verboten und er des Raumes verwiesen wurde, finde ich beschämend — und die Begründung, er hätte ein „Privatanliegen“ nicht vorher angemeldet, klingt nicht nur vorgeschoben, sie ist ein Armutszeugnis. Es zeigt, wie wenig Verantwortungsbewusstsein und Verständnis auf Seiten des Lehrers und der Schulleitung vorhanden waren. Meines Erachtens wäre dies ein Anlass für eine dienstrechtliche Überprüfung und mögliche Konsequenzen.Ich sprach eben den „Fall Emily“ an: Es hätte auch im Interesse des Klassenlehrers und der Schule sein müssen, hier mit Absprachen auf der sicheren Seite zu sein. Dass deshalb die Teilnahme der Tochter auf Klassenfahrt nicht möglich war, ist tragisch für sie und für mich ein weiterer Beleg für eine gelebte Diskriminierung in dieser Schule! Selbstverständlich musste (neben dem Jugendamt) ich als behandelnder Diabetologe nach diesem Vorfall leider ausdrücklich davon abraten, das Kind unter diesen Umständen mit auf Klassenfahrt zu schicken!
Redaktion: Weshalb ist es nach Ihrer Sicht berechtigt, hier von Diskriminierung zu sprechen?
Prof. Pfützner: Diskriminierung bedeutet, dass ein Mensch wegen einer Eigenschaft benachteiligt wird, auf die er keinen Einfluss hat — in diesem Fall wegen einer chronischen Erkrankung und Behinderung. Wenn eine Schule Anweisungen und Hinweise aus einem ärztlichen Attest schlicht ignoriert, die Bedürfnisse des Kindes und Belange der Eltern übergeht, notwendige Nachteilsausgleiche ignoriert oder an fragwürdige Bedingungen knüpft, krankheitsbedingte Verspätungen ohne vorheriges Gespräch abmahnt oder sanktioniert, Notfallmaßnahmen als unverbindlich abtut und dann auch noch die Kommunikation mit den Eltern einstellt — dann ist das für mich systematische Benachteiligung. Hinzu kommt, dass der Notfallplan für schwere Unterzuckerungen monatelang nicht geklärt wurde, obwohl dies gesetzlich klar festgelegt und im Ernstfall lebensrettend ist. Das alles zusammen ist in meinen Augen nichts anderes als Diskriminierung.
Redaktion: Die Notfallmedikation ist ein besonders heikler Punkt. Was ist so problematisch gelaufen?
Prof. Pfützner: Es geht um ein Nasenspray, das im Fall einer schweren Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit verabreicht werden muss. Dieses Spray ist für Laien konzipiert, einfach anwendbar und kann im Notfall Leben retten – oder vor schweren Gehirnschäden bewahren, die durch eine länger anhaltende bedrohliche Unterzuckerung entstehen können. Wenn eine Schule das Kollegium nicht umgehend entsprechend informiert, sondern über Monate hinweg die Verabreichung im Notfall nicht als verpflichtend ansieht, ist das fahrlässig und verstößt gegen die Rechtslage. Gefährlicher Unterzucker kann bei Diabetes Typ 1 durch die Insulintherapie sehr plötzlich entstehen, wenn zu viel wirksames Insulin vorhanden ist, z.B. weil das Essen falsch berechnet oder doch weniger gegessen und in der Folge zu viel Insulin abgegeben wurde. Im Notfall zählt jede Sekunde — es geht hier um das Überleben und die Gesundheit des Kindes!
Redaktion: Wie bewerten Sie die Meldung ans Jugendamt, in der sogar eine nicht näher begründete Sorge um „gewalttätiges Verhalten“ und einen „erweiterten Suizid“ geäußert wurde?
Prof. Pfützner: Das ist der Gipfel der Absurdität. Einer völlig unbescholtenen Familie grundlos zu unterstellen, es könne möglicherweise zu „Gewalt“ oder sogar „erweitertem Suizid“ kommen, ist für mich übel und verleumderisch. Ich betreue die Familie seit Jahren, ich kenne die Kinder seit kurz nach der Diagnose – eine doppelte Diagnose beider Kinder kurz hintereinander ist ein schwerer Schicksalsschlag für eine Familie, die die Herausforderung allerdings vorbildlich bewältigt hat, ohne zu resignieren. Da wären von einer Schule doch einfach Respekt, Anerkennung und Unterstützung angezeigt! Ich kenne die Werte der Kinder und ihre Diabeteseinstellung ist bestens – mit einem überdurchschnittlich guten HbA1c-Wert und einer hervorragenden Blutzuckereinstellung, die ständig mit einem kontinuierlichen Sensor überwacht wird.
Es handelt sich bei den Eltern um völlig normale, engagierte und umsichtige Persönlichkeiten, die sich bei der Betreuung ihrer Kinder vorbildlich verhalten. Das Kindeswohl war zu keinem Zeitpunkt gefährdet und es gab keinerlei Anlass zu befürchten, dass irgendetwas schief geht. In dem Schulkonflikt haben die Eltern sich sogar von mir und externen Anlaufstellen professionell beraten lassen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Eine Meldung ans Jugendamt durch die Schulleitung sollte immer der letzte Schritt sein, wenn man einem Verdacht nachgegangen, das Gespräch mit den Eltern gesucht hat und weiterhin Gründe für Sorgen bestehen. Dies alles hat aber nach meiner Information nicht stattgefunden und das bestätigt auch die Akte. Warum wurden die Eltern nicht darauf angesprochen? Auch ich als ihr Arzt wäre in Sachen Gesundheit der Kinder die erste Ansprechperson gewesen. Diese Meldung ist für mich nicht nur haltloser Quatsch, sondern auch ein klarer Versuch, das Jugendamt in die Irre zu führen und von eigenem Fehlverhalten abzulenken.
Redaktion: Die Schule argumentierte in der Meldung auch damit, Diabetes werde von den Eltern als „schwere Erkrankung“ und „Behinderung“ bezeichnet, was dem Selbstbild der Kinder schaden könne. Wie sehen Sie das?
Prof. Pfützner: Das muss man ja jetzt quasi schon doppelte Diskriminierung nennen! Typ-1-Diabetes ist eine anerkannte, ernst zu nehmende chronische Erkrankung, die bei Kindern und Jugendlichen mit einem Grad der Behinderung sowie Merkzeichen H (Hilflosigkeit) und Pflegegrad verbunden ist — völlig zu Recht. Viele betroffene Kinder haben einen Schwerbehindertenausweis, um ihre Rechte wahrzunehmen. Das hat nichts mit Stigmatisierung zu tun, sondern mit dem Schutz vor Benachteiligung. Das einfach wegzuwischen, ist fachlich falsch und nimmt dem Kind den rechtlichen Anspruch auf Unterstützung. Außerdem suggeriert es, von einer ernsten Erkrankung oder Behinderung zu sprechen, wäre eine Art Beleidigung oder Herabsetzung. Einen solch unreflektierten, faktenwidrigen und diskriminierenden Unfug sollte man nicht von einer professionellen Schulleitung erwarten – und dann auch noch u.a. als Begründung für eine angebliche Kindeswohlgefährdung. Andernfalls muss man die Gefährdung tatsächlich ganz woanders vermuten.
Was sagen Sie dazu, dass die Schulleitung die Eltern im Interview massiv angreift und sogar als „dissozial“ und „eines logischen Diskurses nicht fähig“ bezeichnet?
Prof. Pfützner: Wie bitte?! Abgesehen davon, dass ich die Eltern seit Jahren kenne und weiß, dass sie sich gut informiert, faktisch fundiert und gewissenhaft für das Wohl ihrer Kinder einsetzen: Hat die Schule den Eltern nicht bereits genug geschadet durch m.E. systematische Diskriminierung, Beleidigungen oder üble Verdächtigungen mit den schwersten Vorwürfen, die man Eltern überhaupt machen kann? Ich finde nicht, dass eine seriöse und ernst zu nehmende Schulleitung derartig herablassend und diffamierend über eine betroffene Familie sprechen sollte. Wo bleiben hier die Rechte der Familie sowie ein wenig Respekt und Mitmenschlichkeit? Ich würde den Begriff normalerweise nicht außerhalb eines diagnostischen Kontextes verwenden, aber wenn sich hier jemand „dissozial“ verhalten hat, dann wohl die Schulverantwortlichen.
Redaktion: Was wünschen Sie sich abschließend von Schulen im Umgang mit chronisch kranken Kindern?
Prof. Pfützner: ÜberSchwierigkeiten an Schulen im Umgang mit Diabetes berichten mir Eltern leider immer wieder – auch wenn mir ein solcher Fall wie an der Waldorfschule Mainz in meiner gesamten ärztlichen Laufbahn noch nicht untergekommen ist. Das ist mit Abstand die grottigste Performance einer Schule, die ich je als Diabetologe erlebt habe! Schulen sollten ihre Verantwortung ernst nehmen: Sie brauchen ein Grundverständnis für chronische Erkrankungen, klare Abläufe im Notfall und vor allem eine offene, wertschätzende Kommunikation mit den Familien. Natürlich sollten sich auch die Familien dafür einsetzen und gute Absprachen treffen. Eltern und Ärzte wollen keine überzogenen Sonderrechte oder nerven gar mit „hysterischen Forderungen“ — sie wollen, dass Kinder mit Diagnosen sicher lernen und sich austauschen können, ohne Ausgrenzung oder Angst vor Benachteiligung. Das sollte selbstverständlich sein.
Der Schulleitung der Waldorfschule in Mainz empfehle ich dringend aufzuhören, die Eltern anzugreifen und zu diskriminieren und stattdessen endlich einmal die eigenen Ansprüche laut „Waldorf-Philosophie“ wirklich zu leben: Offiziell spricht die Waldorfbewegung bezüglich ihrer Haltung gegenüber chronisch kranken Kindern von angeblich achtsamer Individualförderung, einer ganzheitlichen Gesundheitsausrichtung und enger interdisziplinärer Kooperation. Ziel soll es sein, betroffene Kinder nicht auszugrenzen, sondern ihre gesunde Entwicklung in einem inklusiven Umfeld bestmöglich zu unterstützen. In diesem konkreten Fall kann ich nun wirklich gar nichts davon erkennen.
Herr Professor Pfützner, haben Sie vielen Dank für das Gespräch!
* Das Interview führte Harald Czycholl für die „Rheinpfalz“. Gesprächsaufzeichnung, Attest, Jugendamtsmeldung und Gesprächsprotokoll/ Stellungnahme des Antidiskriminierungsbüros RLP liegen der Redaktion vor.